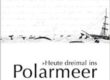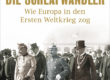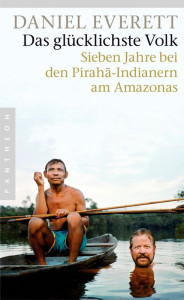
Ich erwache aus tiefem Schlaf. Habe ich geträumt oder tatsächlich dieses Gespräch mit angehört? Es ist halb sieben morgens an einem Samstag im August, in der Trockenzeit des Jahres 1980. Die Sonne scheint bereits, es ist aber noch nicht allzu heiß. Eine warme Brise weht vom Maici herauf, dem Fluss vor meiner bescheidenen Hütte, die auf einer Lichtung am Ufer steht. Ich öffne die Augen und sehe über mir das mit Palmwedeln gedeckte Dach, dessen Gelb vom Staub und Ruß vieler Jahre grau geworden ist. Beiderseits meiner Behausung stehen zwei ähnlich gebaute, aber kleinere Hütten der Pirahä. Dort wohnen Xahoabisi, Kohoibiiihiai und ihre Familien.
Schon oft habe ich den Morgen bei den Pirahä erlebt, wenn der schwache Rauchgeruch von ihren Herdfeuern herüber weht und die brasilianische Sonne mein Gesicht wärmt. Ihre Strahlen werden von meinem Moskitonetz gedämpft. Normalerweise lachen die Kinder, spielen Fangen oder weinen lautstark, weil sie gestillt werden wollen. Überall im Dorf hallen die Geräusche wider. Hunde bellen. Wenn ich hier die Augen aufschlage und benommen aus einem Traum in die Wirklichkeit trete, starrt mich häufig ein Pirahä-Kind oder auch ein Erwachsener an. Sie spähen zwischen den Paxiuba-Palmenmatten hindurch, die die Seitenwände meiner großen Hütte bilden. Aber heute Morgen ist es anders.
Ich bin jetzt völlig bei Bewusstsein, aufgeweckt durch den Lärm und die Rufe der Pirahä. Ich setze mich auf und sehe mich um. Ungefähr sechs Meter von meinem Lager entfernt, auf der Uferböschung des Maici, hat sich eine Menschenmenge versammelt. Alle schreien und gestikulieren energisch. Sie schauen ans andere Ufer, auf eine Stelle gegenüber von meiner Hütte. Ich stehe auf, um besser sehen zu können – an Schlaf ist bei dem Lärm ohnehin nicht mehr zu denken.
Ich hebe meine Sporthose vom Boden auf und achte genau darauf, dass sich keine Taranteln, Skorpione, Hundertfüßer oder andere unerwünschte Gäste in ihr niedergelassen haben. Ich ziehe sie an, schlüpfe in meine Flipflops und trete aus der Tür. Die Pirahä stehen in lockeren Gruppen gleich rechts von meiner Hütte am Flussufer. Ihre Erregung wächst. Ich sehe, wie Mütter den Weg hinunter eilen, während ihre Kinder sich bemühen, die Brust im Mund zu behalten.
Die Frauen tragen die ärmel- und kragenlosen, halblangen Kleidungsstücke, die sie bei der Arbeit wie auch beim Schlafen anhaben. Von Staub und Rauch sind sie dunkelbraun. Die Männer sind in Turnhosen oder Lendentücher gekleidet. Keiner von ihnen hat Pfeil und Bogen bei sich – ich bin erleichtert. Kleine Kinder sind nackt, ihre Haut ist ständig den Elementen ausgesetzt und ledrig-braun. Die Babys haben Hornhaut am Gesäß, weil sie dauernd auf dem Boden herumrutschen, eine Art der Fortbewegung, die sie aus irgendeinem Grund gegenüber dem Krabbeln bevorzugen. Alle sind fleckig von Asche und Staub, die sich auf ihnen ansammeln, wenn sie schlafen oder auf dem Boden am Feuer sitzen.
Noch ist die Luft zwar feucht, aber nur um die zwanzig Grad warm; gegen Mittag werden es 38 Grad sein. Ich reibe mir den Schlaf aus den Augen. Dann erkundige ich mich bei Kohoi, meinem wichtigsten Sprachlehrer, was da los ist. Er steht rechts von mir. Sein kräftiger, schlanker brauner Körper ist angespannt angesichts dessen, was er betrachtet.
„Siehst du ihn nicht da drüben?“, fragt er ungeduldig. „Xigagai, eines der Wesen, die über den Wolken wohnen. Er steht am Strand und schreit uns an, sagt uns, dass er uns töten wird, wenn wir in den Dschungel gehen.“
„Wo?“, frage ich. „Ich kann ihn nicht sehen.“
Rezensionen:
Everett beschreibt seine Erlebnisse bei den Piraha-Indianern spannend wie einen Abenteuerroman. Im ersten Teil erzählt er vom Leben, vom Alltag dieser uns so fremden Menschen. Anschließend kommt der Wissenschaftler in ihm durch und er erläutert gut verständlich die Sprache der Piraha.
Der dritte Teil des Buches ist für mich der wichtigste: Nach einiger Zeit wird der Missionar klar und unmissverständlich von den Piraha dazu aufgefordert, endlich mit dem Gerede über Jesus aufzuhören. Sie sagen ihm, dich Daniel mögen wir, aber mit deinem Jesus, den wir nicht sehen, wollen wir nichts zu tun haben. Das trifft den Missionar hart. Er muss über seine nächsten Schritte nachdenken. Während eines Heimaturlaubs, der erste nach fünf Jahren im Urwald, übersetzt der in Kalifornien geborene Professor für Linguistik an der Illinois State University Daniel L. Everett das gesamte Markusevangelium in die Sprache der Piraha-Indianer. Mit Hoffnung kehrt er zu ihnen zurück. Immer wieder liest er ihnen seine Übersetzung vor, spielt ihnen sogar auf einem Kassettenrecorder den gesprochenen Text vor – alles ohne Erfolg.
Am Ende seines Buches schreibt der Autor: „Die Pirahas sind ein ungewöhnlich glückliches, zufriedenes Volk. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und behaupten, dass die Piraha glücklicher, lebendiger und besser an ihre Umwelt angepasst sind als jeder Christ und jeder andere religiöse Mensch, den ich jemals kennengelernt habe.“ Das sagt der Missionar Daniel Everett als er mehrere Jahre mit den Piraha-Indianern zusammengelebt hat. Er hat seinen Glauben an Gott verloren.
Die Entscheidung seinen Gott aufzugeben macht sich Everett nicht leicht. Er vergleicht sehr intensiv seinen Glauben mit der Lebenseinstellung der Pirahas. Kritisch betrachtet er sein eigenes Leben. Er war Jahrgangsbester seiner Bibelschule und trotzdem wird ihm klar: „Im stillen Kämmerlein war ich Atheist. Und darauf war ich keineswegs stolz.“
Laut Werbung verlor der Missionar Daiel L. Everett seinen Glauben durch die Begegnung mit den Piraha-Indianern. Everett macht aber deutlich, dass die Begegnung mit ihnen nur das I-Tüpfelchen war, das dafür sorgte, dass er es schließlich für alle Welt vernehmlich aussprach.
Vor Menschen die ehrlichen Herzens sagen, sie können nicht glauben, habe ich mehr Respekt als vor den vielen Karteileichen unserer Kirchenarchive. Daniel L. Everett tat es und musste schwer für die Wahrheit bezahlen. Viele seiner Freunde blieben weg und seine Familie zerbrach.
Quelle: Christian Döring